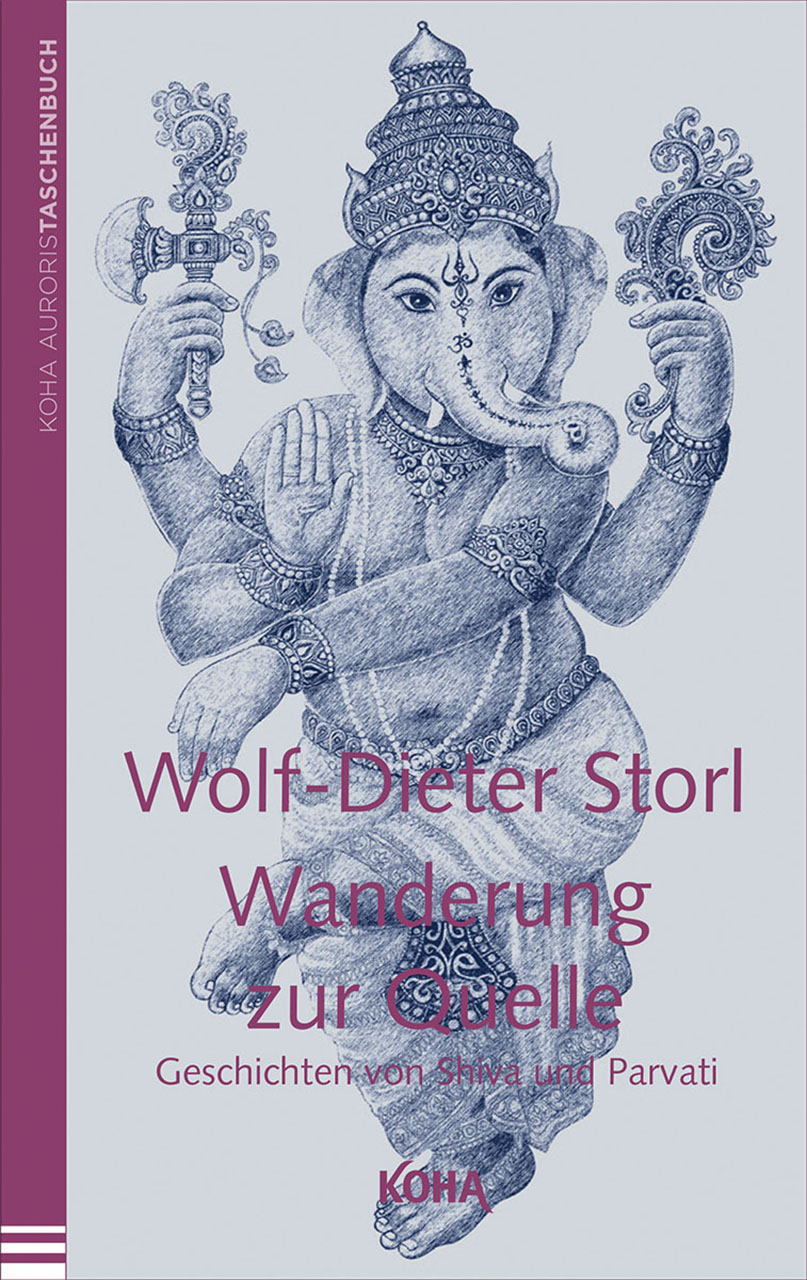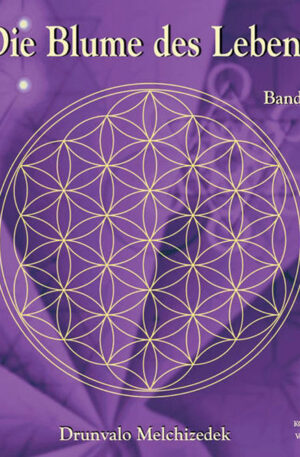Beschreibung
Wolf Dieter Storl – Wanderung zur Quelle
Wer kann schon all das, was unser Sein ausmacht, erfassen und verstehen? Sicherlich nicht die blind im Staub des Materialismus stochernde Wissenschaft. Es sind schon eher die Inspirationen, die sich in Sage und Märchen niederschlagen, die dem Unfassbaren näher kommen. Und nirgendwo sind die Sagenbilder bunter als in Indien, nirgendwo gehen sie tiefer. Das Buch erzählt Märchen und Geschichten über Shiva und Parvati, über das Göttliche, das unser wahres Selbst verkörpert.
Und zugleich erzählt es von einem Ethnologen-Paar, das auf seiner Feldforschungsreise in Indien in eine mythologische Welt hineinstolpert und seelisch verwandelt in den Westen zurückkehrt.
Leseprobe:
Im Frühjahr 1963 bekam John Post von seinem alten Schul-freund Jeremy, der in Harvard einem damals wenig bekannten Psychologieprofessor namens Timothy Leary assistierte. Der Brief enthielt ein weißes Pülverchen von verschwindend geringer Menge, dazu eine Begleitnotiz, es bitte einzunehmen, und falls sich daraufhin irgendwelche psychischen Veränderungen ein-stellen sollten, ihm davon zu berichten. Es handele sich um ein Forschungsprojekt. John hatte es eilig. Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, rührte er das Pülverchen in den Kaffee, rauchte die Pall Mall fertig und machte sich auf den Weg zum Campus. Beim Gehen versuchte er wie gewohnt, sich sein Vorlesungsthe-ma noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Aber irgendwie konnte er sich für das sudanesische Verwandtschaftssystem und den afrikanischen Brautpreiskomplex nicht begeistern.Die Studenten rutschten schon ungeduldig auf ihren Sitzen hin und her, kicherten, kauten, bohrten in der Nase, lasen Co-mics und klickten nervös mit den Kugelschreibern, als er den Hörsaal betrat. Grußformeln, belanglose Wortfetzen purzelten wie achtlos weggeworfene Hamburger-Schachteln oder Cola-Büchsen bezugslos durch den Raum. Die Heizkörper verduns-teten grobe chemische Düfte, und die Neonröhren beleidigten Johns Augen. Das eigenartige Pülverchen schien doch etwas zu bewirken, denn so hatte er die Dinge noch nie bemerkt. »Die Vorlesung fällt heute aus!«, war alles, was er von sich zu geben vermochte – eine Mitteilung, die mit Yippie- und Yeah-Rufen quittiert wurde.Unten an der Straße stand plötzlich Cindy vor ihm. »Hey«, strahlte sie ihn an, »heute läuft ein Sonderprogramm. Französische Filme. Alain Delon und so!« Sie hakte sich bei ihm ein und zog ihn ins gegenüberliegende Campus-Kino. In der Dunkelheit des Saals spürte er ihre Körperwärme, wie er sie noch nie zuvor gespürt hatte, wie Signale von einem ande17ren Planeten. Das rastlose Geflüster und Geplauder, das Rascheln und Räuspern, welches ihm wie eine meisterhafte Komposition vorkam, wich schlagartig dem Summen und flackernden Lichtstrahl des Projektors. Die im Saal zerstreuten Energien einten sich und flossen Richtung Leinwand. Mit gekonntem charismatischem Blick und der Hilfe musikalischer Untermalung verzauberte der Star – in der Rolle des leidgeprüften Vagabunden – die Zuschauer. Noch vorm Kinoeingang hätten die Filmfans einen derartig verwahrlosten Typen mit gleichgültiger Verachtung gestraft, hier aber flogen ihm die Herzen zu. Für ihn schluchzten, seufzten und atmeten sie tief durch. Hier und da lachten sie wie aus einem Mund. Ein Regisseur programmiert eben nicht nur die Schauspieler, sondern vor allem das Publikum. Auch Cindy und John waren Teil der kollektiven Zuschauerseele, die wie ein Schwarm Fische im fein geknüpften Netz der wechselnden Szenen gefangen war. John jedoch sah sich plötz-lich durch die Maschen schwimmen. Hinter dem Zaubernetz entdeckte er schwitzende, leicht alkoholisierte, blasierte Schau-spieler, die krampfhaft oder auch gelassen ihre Verstellungs- und Nachahmungskünste ausübten.
Zugleich schwamm er durch den Kopf des Spielleiters, schaute durch seine Brille, zog an seiner Zigarette, stolperte durch das Filmskript, spürte die versteckten Absichten und verbrämten Botschaften, den emotionalen Gleit-stoff, die ideologischen Widerhaken. Ebenso sonnenklar, aber auf völlig anderer Ebene erlebte er das tanzende Licht- und Schat-tenspiel auf der Leinwand und genoss es, als würde eine Brise über die Oberfläche eines Teiches streichen und ein Wellenge-kräusel malen. Zugleich flüsterte der muffige Geruch des Saales ihm noch nie wahrgenommene Geheimnisse zu, sprach von den Menschen, die hier täglich ein und aus gingen, als hätten sich ihre Ausstrahlungen in die Wände eingraviert.Draußen wehte der Märzwind, wie er schon seit Jahrtausen-den geweht hatte, als es noch keine Indiana State University gab, als hier noch mächtige Laubwälder wuchsen und die Shawnee-Indianer den Rehen nachpirschten. Obgleich die Backstein-mauern ihn abschirmten, wehte der Wind dennoch geisterhaft durch den Saal, ließ vor Johns innerem Auge die Urwälder wieder entstehen, ließ die Balken des Gebäudes morsch, das Gemäuer brüchig werden und im Strom der Zeit zur Ruine verfallen. Der ganze Campus bestand aus moos- und efeubewachsenen Trüm-mern, in dessen Nischen dieselben Waldvögel ihre Nester bauten, die man soeben da draußen im Märzwind zwitschern hörte. Jählings wurde die Leinwand still und hell. Strom schoss in die Deckenbeleuchtung. Die Zuschauer standen auf, als hätte ein unsichtbarer Feldwebel sein Kommando herausgebellt: »Aufste-hen! Realitätswechsel!« Wie ein gut gedrillter Soldatentrupp defi-lierten sie hinaus in einen anderen Film – den dreidimensionalen amerikanischen Traum.Auch Cindy war aufgesprungen und zog ihn am Ärmel des Cordsamtjacketts. John blieb sitzen. Er fand die leere Leinwand, still und weiß wie frischer Schnee, eigentlich noch schöner als das nervös flackernde Licht- und Schattenspiel. Und Zeitdruck war eine Peitsche, vor der er nicht kuschen wollte. Cindy holte tief Luft: »Was ist heute bloß mit dir los?«, fragte sie verärgert. »Zeit ist Illusion«, antwortete er gelassen und ließ sie gehen. Das Zauberpülverchen, von dem er nicht die geringste Ahnung hatte, was es sein könnte, hatte ihm eine simultane Vielschichtigkeit der »Wirklichkeit« offenbart, hatte seinem Hirn einen Riss gegeben, durch den ein Wesen höheren Bewusstseins hindurchlächelte. Noch kannte er den Namen Shivas, des stillen Zeugen, in dem alle »Realitäten« münden, nicht. Noch wusste er nicht, dass einer seiner vielen Namen Aushadhishvara, »Herr der be-wusstseinserweiternden Heilkräuter und Substanzen«, ist, dass er Sharva, der wilde Jäger, ist, dessen Lust es ist, unseren flüch-tigen Seelen im Dschungel der Illusionen nachzujagen und das gepanzerte Ego zu zerlegen. Noch kannte John den kosmischen Trickster nicht, den Prinzen der Diebe (Sthenanam Pathaye), der sich unerkannt in unser Leben hineinschleicht und der wir selber sind.

Wolf-Dieter Storl ist geboren in Sachsen und aufgewachsen in den USA. Er ist Ethnobotaniker und Kulturanthropologe. Zwanzig Jahre lang lehrte er als Dozent und College-Professor an verschiedenen Universitäten in den USA in den USA, in Indien und Europa. Seit 1988 lebt er mit seiner Famile als freischaffender Schriftsteller im Allgäu. Von Wolf-Dieter Storl sind zahlreiche Bücher und Artikel in Zeitschriften erschienen und er hält Vortäge und Seminare.